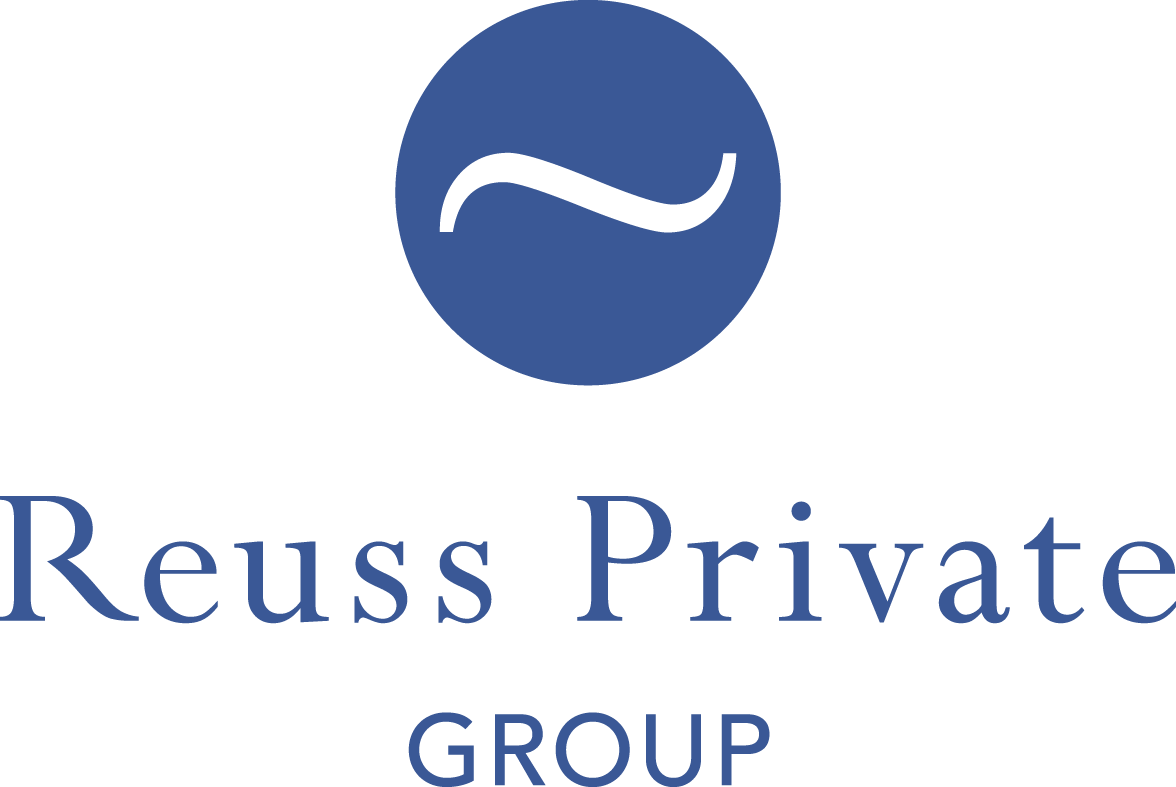Vertreibung aus dem Frankenparadies
von
Felix Brem
Felix Brem, CEO der Reuss Private Group, beurteilt im Artikel von Simon Schmid, Tages-Anzeiger, wie die Schweizer auf die Aufgabe des Frankenmindestkurses reagieren werden.
Die Nationalbank will möglichst wenig Ausnahmen von den Negativzinsen zulassen. Hintergrund dieser Politik ist ein langjähriges Ungleichgewicht in der Schweizer Volkswirtschaft. Von Simon Schmid
In der Deutschschweiz steht Jean-Pierre Danthine selten im Rampenlicht. Doch was der Vizepräsident über die SNBPolitik sagt, ist meist zentral. Etwa bei den Negativzinsen. Warum handhabt die Nationalbank die Massnahme so streng? Warum sollen Krankenkassen und berufliche Vorsorge partout keine Ausnahmen davon erhalten?
Um das zu erklären, schlug Danthine am vergangenen Donnerstag einen weiten Bogen – von der Exportstatistik über die Zinsen zum Sparverhalten. Die Quintessenz der Ausführungen: Je weniger Ausnahmen gemacht werden, desto wirksamer halten Negativzinsen nicht nur Auslandsgelder von der Schweiz fern, sondern treiben auch inländische Anleger ins Ausland.
Dass die SNB auf diese Weise den Franken schwächen will, hat seinen Grund. Denn die Schweizer Sparer sind mitschuldig daran, dass der Franken überhaupt so stark geworden ist. Dies, weil sie sich nach der Finanz- und Eurokrise in ihr Schneckenhaus zurückgezogen haben. Sowohl die Direktinvestitionen von Unternehmen, als auch die Portfolioinvestitionen von Privatleuten im Ausland gingen damals spürbar zurück. «Der ausbleibende Kapitalexport ist mit ein wichtiger Grund für den starken Franken», sagt Rudolf Minsch, Chefökonom von Economiesuisse.
Aufschluss über die Proportionen dieses Phänomens gibt die offizielle Zahlungsbilanz. Darin waren früher um die 60 Milliarden Franken an Portfolioinvestitionen pro Jahr verbucht – also Wertpapierkäufe des Privatsektors im Ausland. Das ist rund doppelt so viel Geld, wie über Aktien- oder Obligationenkäufe umgekehrt in die Schweiz hineinfloss.
Vorsichtige Anleger
Nach der Krise verschwanden diese systematischen Überschüsse. Einzig die SNB agierte zwischenzeitlich als Fremdwährungskäuferin. «Die Nationalbank ist eine Weile in die Bresche gesprungen», sagt Thomas Härter, Chefstratege beim Fondshaus Swisscanto. «Jetzt wünscht sie sich, dass auch der Privatsektor wieder mehr Kapital exportiert.»
Der Negativzinspolitik attestiert er in dieser Hinsicht einen gewissen Erfolg. In den letzten Monaten hätten Anleger bereits begonnen, wieder mehr Geld im Ausland zu investieren, so Härter. Auch institutionelle Grossanleger hätten nun mit der Anpassung begonnen, sagt Oliver Kunkel, Anlageexperte beim Beratungsunternehmen PPCMetrics. «Viele Pensionskassen können ihre Zielrenditen heute nicht mehr einfach mit Bundesobligationen erreichen.» Gehe eine Kasse nun mehr Anlagerisiken ein, dann erhöhe sich typischerweise auch der Anteil ausländischer Investments.
Das Kalkül der SNB ist aber selbst mit Risiken verbunden. Negativzinsen könnten Anleger nämlich auch in die private Geldhortung statt ins Ausland treiben. «Seit der Finanzkrise sind die Anleger vorsichtiger geworden», sagt Felix Brem, Chef des Vermögensverwalters Reuss Capital. «Früher waren Geldanlagen im Ausland – etwa Festgeld bei europäischen Banken – verbreitet. Heute geniesst das Bankensystem generell weniger Vertrauen.» Laut Brem hat die Mindestkursaufgabe viele Schweizer sogar im Glauben bestärkt, dass der Franken der beste Anlagehafen ist.
Dass die Schweiz überhaupt auf Kapitalabflüsse angewiesen ist, liegt an ihrer Wirtschaftsstruktur. Genauer: am grossen Leistungsbilanzüberschuss, den sie im Handel mit dem Rest der Welt erzielt. 2014 lag er bei 7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Dieser Überschuss im realen Güter- und Dienstleistungshandel ist das Spiegelbild der Situation bei den Finanzströmen.
Die Exportvolumen sind trotz Eurokrise nicht geschrumpft. 2014 resultierte ein totaler Überschuss von 70 Milliarden Franken durch den Handel mit Waren (Pharma, Uhren, Maschinen etc.), mit Dienstleistungen (Finanzbranche, Tourismus) und dem Transithandel (Rohstoffe). Die Importe sowie andere Negativposten in der Leistungsbilanz, wie etwa die Löhne von Grenzgängern, kamen an diese Summe bei weitem nicht heran. Dass der Franken unter permanentem Aufwertungsdruck steht, ist auch eine Folge dieser Konstellation.
Die Doppelrolle der SNB
Beim amerikanischen Peterson Institute hält man den hohen Exportüberschuss der Schweiz schon länger für fragwürdig. Die dortigen Ökonomen forderten die SNB bereits in der Vergangenheit auf, die Geldpolitik zu ändern, damit sich der Überschuss abbauen kann. Bei der Nationalbank wehrte man sich jeweils mit statistischen Argumenten gegen den Vorwurf, ein merkantilistisch motivierter Währungsmanipulator zu sein. Die Überschüsse seien buchhalterisch überzeichnet, zudem sei etwa der Rohstofftransithandel ohnehin resistent gegenüber der Währungspolitik.
Die Kritik an der SNB hat sich mit der Aufhebung des Mindestkurses erübrigt. Doch die hiesige Wirtschaft funktioniert weiterhin nach dem Recycling-Prinzip: Hohe Exportüberschüsse müssen durch Vermögenskäufe oder durch Kredite im Ausland kompensiert werden (sofern die SNB keine Fremdwährungen kauft). In den Nullerjahren funktionierte das System dank schwachen Kursen von 1.55 Franken pro Euro. Heute steht eine Neutarierung an. Das muss nichts Negatives sein, wie Thomas Härter von Swisscanto sagt: «Wenn der starke Franken dazu führt, dass die Schweiz ausgabefreudiger wird, dann ist das gut so.»
Die Nationalbank spielt vor diesem Hintergrund eine doppelte Rolle. Mit der Frankenaufwertung lässt sie einerseits mehr Importe zu. Anderseits setzt sie die Negativzinsen dafür ein, dass der Abbau der Exportüberschüsse nicht abrupt passieren muss: Der Strukturwandel soll etwas entschleunigt werden. Anleger aktiv aus dem Frankenparadies zu vertreiben, ist ein Teil dieser geldpolitischen Übergangsstrategie.